 |
|
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden
"Spurensuche
nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche
Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/
|
|
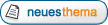 |
 |
|
Anfang
zurück
weiter
Ende
|
| Autor |
Beitrag |
Gast
|
 Erstellt: 04.08.08, 09:36 Betreff: Zusammenhang zwischen Suchterkrankungen der Eltern und der Entwicklung von Kindern
drucken
weiterempfehlen Erstellt: 04.08.08, 09:36 Betreff: Zusammenhang zwischen Suchterkrankungen der Eltern und der Entwicklung von Kindern
drucken
weiterempfehlen
|
 |
|
28. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Suchterkrankungen der Eltern und der Entwicklung von Kindern?
Heinz Kindler
Suchterkrankungen bei Eltern umfassen die Abhängigkeit von Alkohol, Opioiden (z.B. Heroin), Kokain und anderen psychotropen Stoffen.1 Während vor allem für die Abhängigkeit von Alkohol und Heroin etliche Informationen über die Zusammenhänge zur Entwicklung der Kinder der von diesen Suchterkrankungen betroffenen Eltern vorliegen, spielen andere Suchtstoffe (z.B. Beruhigungstabletten) in der Literatur bislang eine randständige Rolle. Da bei einem erheblichen Teil der von Suchterkrankungen betroffenen Eltern zusätzliche psychische Erkrankungen vorliegen,2 lassen sich die bei Kindern suchtkranker Eltern beobachtbaren Beeinträchtigungen im Entwicklungsverlauf häufig nicht allein auf die elterliche Suchterkrankung zurückführen. Für die Soziale Arbeit bedeutet dies u.a., dass die Einschätzung der Entwicklungschancen eines Kindes bei den Eltern nicht vorschnell auf eine vorhandene Suchterkrankung und deren Behandlung verengt werden darf. Da nicht selten auch der andere – nicht suchtkranke – Elternteil psychiatrische Auffälligkeiten aufweist,3 erleben viele Kinder mit einem suchtkranken Elternteil bei beiden Eltern vorhandene, wenngleich unter Umständen unterschiedliche Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit.
Entwicklungsverlauf und psychische Störungen bei Kindern suchtkranker Eltern
Bei Kindern alkoholabhängiger Eltern wurde vielfach eine Übernahme elterlicher Trinkmuster und daher ein erhöhtes Risiko für eine spätere Alkoholabhängigkeit vermutet. In mehr als einem Dutzend Studien fand sich tatsächlich ein im Durchschnitt zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, im Jugend- bzw. jungen Erwachsenenalter zu erkranken.4 Für Deutschland würde dies einer Lebenszeitprävalenz von 16 bis 24 Prozent entsprechen. Wird der Blick auf die psychische Gesundheit insgesamt ausgeweitet, so scheint bei 40 bis 60 Prozent der betroffenen Jugendlichen mindestens eine psychiatrische Erkrankung feststellbar.5 Auch im Kindesalter wurde bereits eine erhöhte Belastung durch psychiatrisch relevante Auffälligkeiten beobachtet,6 insbesondere im Hinblick auf Aufmerksamkeitsstörungen, Impulsivität und ausagierendes Verhalten. Zum Bereich depressiver oder durch Angst gekennzeichneter Störungen wurden dagegen bei betroffenen Kindern und Jugendlichen im Mittel nur schwache oder situative, d.h. durch Trinkepisoden der Eltern ausgelöste, vorübergehende Zusammenhänge gefunden.7 Unterhalb der Schwelle psychiatrisch relevanter Auffälligkeiten fanden sich Belastungen im Hinblick auf den Verlauf der geistigen bzw. schulischen Entwicklung. Wenngleich die Mehrzahl der untersuchten Kinder hierbei trotz im Mittel unterdurchschnittlicher Leistungen im Bereich altersgemäßer Entwicklung verblieb, ergaben sich bei Kindern alkoholabhängiger Eltern doch erhöhte Raten an Intelligenzminderungen, Lernstörungen, abgebrochenen Schulkarrieren und erfolglosen Berufslaufbahnen.8 Wurden Unterschiede in den Entwicklungsverläufen von Kindern alkoholabhängiger Elternteile betrachtet, so trat eine hochgradig gefährdete Gruppe von Kindern hervor, die auf der Grundlage eines frühkindlich schwierigen Temperaments bereits im Kindergarten- und Grundschulalter ausagierende Verhaltensstörungen entwickelte und nachfolgend ein eher negatives Bild von Autoritäten und ein eher positives Bild von Regelverletzungen und Suchtmittelkonsum ausbildete.9
Im Vergleich zu den Auswirkungen elterlicher Alkoholabhängigkeit scheinen bei Kindern mit mindestens einem opiatabhängigen Elternteil im Mittel stärkere Beeinträchtigungen der Entwicklung vorfindbar.10 In den vorliegenden Untersuchungen zeigten 50 bis 60 Prozent der untersuchten Kinder psychiatrisch relevante Störungen, obwohl sich betroffene Eltern ganz überwiegend in Behandlung befanden und teils mehrjährig substituiert wurden.11 Auch andere Indikatoren12 deuten auf im Mittel erhebliche Belastungen im Entwicklungsverlauf hin, wobei die wenigen vorliegenden Längsschnittstudien eine häufige Problemeskalation mit zunehmendem Alter vermuten lassen.
Woraus ergeben sich Belastungen in der Entwicklung von Kindern suchtkranker Eltern?
Zusammenhänge zwischen elterlicher Suchterkrankung und Belastungen kindlicher Entwicklung können sich aus einem Zusammenwirken verschiedener Vermittlungsmechanismen ergeben.13 Ein solcher Vermittlungsmechanismus führt hierbei über die Weitergabe genetischer Belastungen und die Effekte eines mütterlichen Suchtmittelgebrauchs während der Schwangerschaft zu Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung.14 Ein zweiter Pfad führt direkt von Einschränkungen der elterlichen Fürsorge- und Erziehungsfähigkeit zu Belastungen kindlicher Entwicklung. Dieser Pfad beinhaltet chronische oder wiederholt – während Phasen des Suchtmittelgebrauchs – auftretende Einschränkungen in der Fähigkeit eines Elternteils, dem Kind als feinfühlige Bindungsperson zur Verfügung zu stehen, notwendige Regeln zu vermitteln und die geistige Entwicklung zu fördern.15 Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit können bis zum Vorkommen von Misshandlung oder Vernachlässigung reichen.16 Auf einem dritten Pfad wirkt sich eine elterliche Suchterkrankung über ihre familiären und sozialen Begleiterscheinungen indirekt belastend auf das Kindeswohl aus.17 Zu denken ist hier etwa an eine drastisch erhöhte Häufigkeit von Partnerschaftsgewalt in Familien mit einem suchtkranken Elternteil, ebenso an die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Trennung bzw. Scheidung und ökonomische Belastungen infolge von Suchterkrankungen (z.B. Kündigungen, Arbeitsunfähigkeit). Eine Abhängigkeit von illegalen Drogen geht zudem vielfach mit weiteren kriminellen Aktivitäten und Strafverfolgung einher. Die verschiedenen Vermittlungsmechanismen zwischen elterlicher Suchtmittelabhängigkeit und Belastungen kindlicher Entwicklung sind unterscheidbar, aber nicht unabhängig voneinander.18 Zudem wurden im Hinblick auf eine nochmalige Steigerung der Risiken für betroffene Kinder mehrfach Wechselwirkungen mit weiteren psychischen Erkrankungen bei den Eltern beschrieben.19
Folgerungen für Soziale Arbeit mit suchtmittelabhängigen Eltern
Selbst bei einer gegebenen Veränderungsmotivation scheint eine dauerhafte Suchtmittelfreiheit für die meisten betroffenen Eltern nur als Ergebnis eines jahrelangen Prozesses mit mehrfachen Rückfällen erreichbar zu sein. Innerhalb der zeitlichen Grenzen, die durch die Unaufschiebbarkeit kindlicher Bedürfnisse und die Geschwindigkeit kindlicher Entwicklung gesetzt werden, ist eine erfolgreiche Behandlung elterlicher Suchtmittelabhängigkeit daher häufig nicht zu erreichen. Waren in der Vergangenheit international hohe Raten an Fremdunterbringungen bei Kindern zu beobachten, deren Eltern entweder bekanntermaßen illegale Drogen konsumierten oder bei denen es zusätzlich zu einer elterlichen Alkoholabhängigkeit zu Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung gekommen war,20 so wurde in den letzten Jahren in den Jugendhilfesystemen verschiedener Länder versucht, Fremdunterbringungen häufiger zu vermeiden. Insofern dabei durch wiederholte Rückfälle bei einer Substitutionstherapie, den Beikonsum anderer Drogen, unbehandelte psychische Störungen bei Eltern bzw. Kindern oder fortlaufende Erziehungsschwierigkeiten keine dauerhafte Verbesserung der Situation von Kindern erreicht werden konnte, waren teilweise kontraproduktive Effekte zu beobachten. Die notwendige Intensität und Fokussierung von Interventionen ist daher zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Aus den bislang vorliegenden Evaluationen lassen sich hierbei drei vorläufige Schlussfolgerungen ableiten:
* Bei Interventionen sind Eltern und Kinder als Klienten mit jeweils eigenständigen Bedürfnissen anzusehen. Eine Konzentration auf die Stabilisierung der elterlichen Lebenssituation allein hat in mehreren Projekten nicht ausgereicht, um die Erziehungsfähigkeit zu verbessern oder bereits laufende abweichende Entwicklungsprozesse bei Kindern zu stoppen.21
* Interventionen, die eventuell vorhandene komorbide Störungen oder evtl. vorhandene Suchterkrankungen einer zweiten, mit dem Kind zusammenlebenden Bezugsperson nicht berücksichtigten, waren in der Regel erfolglos.22
* Erfolgreiche Interventionen23 erfordern eine Zusammenarbeit von Sucht-und Jugendhilfe und setzen an mehreren Stellen (Suchtproblematik, Lebenssituation, Eltern-Kind-Beziehung) an. Trotz eines zunächst erforderlichen relativ hohen Mitteleinsatzes erweisen sie sich langfristig als am kostensparendsten.
Weiterführende Literatur
Barnard M. & McKeganey N. (2004). The impact of parental problem drug use on children: What is the problem and what can be done to help? Addiction, 99, 552-559.
Klein M. (2001). Lebensqualität der Kinder von Opiatabhängigen: Fiktion, Tabu und Realität. In B. Westermann, C. Jellinek & G. Bellmann (Hg.), Substitution: Zwischen Leben und Sterben. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 61-80.
Tunnard J. (2002a). Parental Problem Drinking and its Impact on Children. Research in Practice Series No. 4, Totnes: Dartington Social Research Unit.
Anmerkungen
1 Die Kriterien einer Abhängigkeit und die verschiedenen Gruppen psychotroper Stoffe finden sich unter der Kennziffer F1 im Kapitel V der „Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme (ICD)“ der Weltgesundheitsorganisation. Der Volltext ist kostenlos über das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) unter www.dimdi.de/de/klassi/diagnosen/ zugänglich. Einführungen in den Wissensstand über die Entstehung und die gesundheitlichen Auswirkungen verschiedener Suchterkrankungen finden sich bei Ladewig 2003 und Watzl / Rockstroh 1997.
2 Nach den gegenwärtig vorliegenden epidemiologischen Befunden (z.B. Kessler et al. 1996, Petrakis et al. 2002, Jacobi et al. 2004) liegen bei etwa 40 bis 60 % suchtkranker Personen weitere psychiatrisch relevante Störungen vor. Vor allem Depressionen, Angsterkrankungen und einige Formen der Persönlichkeitsstörung scheinen die Ausbildung einer Suchterkrankung erheblich zu begünstigen.
3 Z.B. Jacob / Bremer 1986, Maes et al. 1998, Clark et al. 2004.
4 Für eine Forschungsübersicht s. Russell 1990; seitdem sind zu diesem Thema u.a. die Längsschnittstudien von Knop et al. 1993, Lynskey et al. 1994 sowie Chassin et al. 1999 erschienen. Aus Deutschland stammt die Vier-Jahres-Längsschnittstichprobe von Lieb et al. 2002.
5 Für eine Forschungsübersicht s. Wilens 1995, seitdem wurden u.a. Studien von Kuperman et al. 1999 sowie Chassin et al. 1999 veröffentlicht.
6 Für Forschungsübersichten s. West / Prinz 1987, Wilens / Biederman 1993.
7 S. Sher 1997, Preuss et al. 2002.
8 Eine Forschungsübersicht zur kognitiven und schulischen Entwicklung betroffener Kinder findet sich bei Zobel 2000. Zur Häufigkeit von Lernstörungen s. Martin et al. 2000. Für eine Längsschnittstudie zu den Lebensressourcen und dem beruflichen Werdegang bis in Erwachsenenalter hinein s. Christoffersen / Soothill 2003.
9 S. Fitzgerald et al. 2002.
10 In zwei Untersuchungen (Wilens et al. 2002, Kelley / Fals-Stewart 2004), die Kinder alkohol- und opiatabhängiger Eltern direkt verglichen, zeigten sich jeweils größere Beeinträchtigungen der Entwicklung bei Kindern mit mindestens einem opiatabhängigen Elternteil.
11 Eine Literaturrecherche in Datenbanken (Psychinfo, PubMed, Eric) und aktuellen Übersichtsarbeiten (Hogan 1998, Johnson / Leff 1999, Drummond / Fitzpatrick 2000, Klein 2001c, Mayes / Truman 2002, Tunnard 2002 b, Barnard / McKeganey 2004) erbrachte empirische Studien aus 20 Stichproben, in denen die Entwicklung von Kindern opiatabhängiger Eltern untersucht wurde und die zugleich minimale methodische Voraussetzungen erfüllten. In sieben Stichproben wurden auf der Grundlage von klinischen Interviews standardisierte psychiatrische Diagnosen vergeben. Die Bandbreite reichte von 47 bis 88 % betroffener Kinder mit mindestens einer psychiatrischen Diagnose. In vier Stichproben erwiesen sich zwischen 50 und 60 % der untersuchten Kinder als psychiatrisch belastet. Die untersuchten Kinder befanden sich überwiegend in der mittleren Kindheit (acht bis zwölf Jahre). Schwerpunkte der vergebenen Diagnosen lagen bei affektiven (z.B. Depression) und ausagierenden Störungen. Aufgrund verschiedener Untersuchungsmerkmale (Eltern teils langjährig in Behandlung, häufigere Nichtteilnahme bei ungünstigem Behandlungsverlauf) ist zu vermuten, dass die Befundlage die tatsächliche Häufigkeit auftretender Störungen bei betroffenen Kindern eher unterschätzt.
12 Z.B. Einschätzungen der globalen psychosozialen Anpassung (z.B. Nunes et al. 1998), Einschätzungen von Lehrkräften (z.B. Hans 1996), Raten an Sonderbeschulung (z.B. Wilens et al. 2002), Delinquenz im Selbstbericht (z.B. Nurco 1999).
13 Für eine modellhafte Beschreibung verschiedener Vermittlungswege s. Mayes 1995.
14 Zwillings- und Adoptionsstudien deuten darauf hin, dass genetische Faktoren bei der Ausbildung einer Suchterkrankung, und zwar insbesondere beim Übergang vom Suchtmittelgebrauch zur Abhängigkeit, eine Rolle spielen können (für Forschungsübersichten s. McGue 1997, Johnson / Leff 1999). Insoweit eine Suchtmittelerkrankung sekundär zu einer anderen psychischen Erkrankung auftritt, kommt auch eine genetische Weitergabe der Vulnerabiliät für die Primärerkrankung in Betracht. Die Möglichkeit vorgeburtlicher Schädigungen durch einen Suchtmittelgebrauch während der Schwangerschaft ist für Alkohol sehr gut belegt (für eine Forschungsübersicht s. Zobel 2000). Bei einer schweren Schädigung wird hierbei von einer Alkoholembryopathie gesprochen, in leichteren Fällen von bestehenden oder möglichen Alkoholeffekten. Langfristige Folgen einer vorgeburtlichen Schädigung durch Alkohol wurden in Langzeituntersuchungen vor allem für verschiedene Aspekte der Verhaltenssteuerung und Lern- bzw. Planungsfähigkeit sowie für eine erhöhte negative Affektivität belegt (z.B. Streissguth et al. 1999). Ein mütterlicher Opiatkonsum während der Schwangerschaft führt zur Abhängigkeit des Kindes und zu Entzugssymptomen nach der Geburt. Im Unterschied zu milden Beeinträchtigungen scheinen schwere und dauerhafte Schädigungen aber selten, wenngleich Langzeituntersuchungen noch weitgehend fehlen (für Forschungsübersichten s. Hans 1996, Lester et al. 2000, Mayes / Truman 2002). Bei guter Förderung ist vielfach ein Ausgleich früher Defizite zu erreichen. Fälle von plötzlichem Kindstod treten allerdings überdurchschnittlich häufig auf.
15 Einschränkungen in der Fähigkeit von suchtkranken Eltern, als sichere Bindungsperson in der frühen Kindheit zu fungieren, waren in der überwiegenden Mehrzahl der mittlerweile mehr als 20 Studien feststellbar, in denen entweder kindliche Bindungsmuster oder die elterliche Fähigkeit zur feinfühligen Interaktion beobachtet wurden (für Forschungsübersichten s. Mayes / Truman 2002, Seifer et al. 2004). Die mittlere Häufigkeit desorganisierter Bindungsmuster scheint jedoch unter den Raten zu liegen, die in Stichproben misshandelnder oder schizophrener Elternteile beobachtet wurden. Dies und die Uneinheitlichkeit der Befunde spricht dafür, dass einigen Eltern in den ersten Lebensjahren ihres Kindes auch bei fortgesetztem Suchtmittelkonsum eine Abschirmung des Suchtmittelgebrauchs (z.B. Hogan 2003) gelingt, sodass negative Effekte auf die elterliche Interaktionsbereitschaft und Feinfühligkeit zwar u.U. feststellbar sind, für eine nachhaltige Belastung der Bindungsbeziehung des Kindes aber nicht ausreichen. Bei älteren Kindern werden vor allem in der klinischen Literatur Prozesse der Rollenumkehr und Parentifizierung beschrieben (Tunnard 2002 a, b), die die ursprüngliche Bindungsbeziehung überlagern können, jedoch fehlen hierzu wissenschaftliche Untersuchungen. Im Hinblick auf die nach dem ersten Lebensjahr bedeutsam werdende Fähigkeit zur Vermittlung von Regeln und Werten scheinen in vielen Fällen eingeschränkte elterliche Fähigkeiten in Form einer erhöhten Reizbarkeit und Strafbereitschaft sowie größeren Inkonsequenz auf einen erhöhten Erziehungs- und Anleitungsbedarf bei Kindern zu treffen, der sich aus einer vielfach erhöhten Unruhe, Impulsivität und negativen Affektivität ergibt (z.B. Tarter et al. 1993, Hans et al. 1999, Miller et al. 1999). Auf Seiten der Eltern werden Einschränkungen in diesem Bereich der Erziehungsfähigkeit durch lebensgeschichtliche Faktoren (z.B. erfahrene Misshandlungen, Störung des Sozialverhaltens in der eigenen Kindheit), belastende Merkmale der Lebenssituation (z.B. Armut, Familienkonflikte) und eine evtl. vorhandene Komorbidität (z.B. Depression, antisoziale Persönlichkeitsstörung) begünstigt. Im Ergebnis erhöht sich durch diese Situation auf Seiten betroffener Kinder die Wahrscheinlichkeit einer Ausbildung ausagierender Verhaltensauffälligkeiten, auf Seiten der Eltern die Auftretenswahrscheinlichkeit von Überforderungsgefühlen (z.B. Kettinger et al. 2000) mit der möglichen Folge eskalierender Eltern-Kind-Konflikte oder eines frühzeitigen Rückzugs der Eltern aus ihrer Anleitungs- und Beaufsichtigungsaufgabe (z.B. Chassin et al. 1993). Die Fähigkeit suchtkranker Eltern zur kognitiven Förderung ihrer Kinder hat schließlich bislang die wenigste Aufmerksamkeit in der Forschung erfahren. Vorliegende Arbeiten konzentrieren sich zudem auf die frühe Kindheit und berichten ein im Mittel unterdurchschnittliches Maß an kognitiver Förderung und häuslicher Anregung (z.B. Noll et al. 1992, Pajulo et al. 2001).
16 Ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiko ergibt sich aus mehreren Informationsquellen. Hierzu zählen rückblickende Befragungen erwachsener Kinder von suchtkranken Eltern, in denen im Mittel eine Verdopplung bis Verdreifachung des Risikos von Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch gefunden wurde (z.B. Dube et al. 2001, Walsh et al. 2003). Weiterhin zeigen zwei epidemiologische amerikanische Studien mit einem Querschnitt- bzw. Kurzzeitlängsschnittdesign eine mindestens dreifach erhöhte Rate von Kindesvernachlässigung (Kirisci et al. 2001) bzw. Misshandlung und Vernachlässigung (Chaffin et al. 1996) bei Familien mit mindestens einem suchtkranken Elternteil. Ebenso werden aus Längsschnittstudien an Kindern, die pränatal Suchtstoffen ausgesetzt waren, mehrfach erhöhte Raten an späteren Misshandlungen bzw. Vernachlässigungen berichtet (z.B. Kienberger-Jaudes et al. 1995, Kelley 1998), gleichzeitig steigt bei einer fortbestehenden Suchtmittelabhängigkeit die Wahrscheinlichkeit wiederholter Vorfälle (z.B. Wolock / Magura 1996, Fuller / Wells 2003). Schließlich zeigen die Jugendhilfestatistiken verschiedener Staaten eine im Verhältnis zur Prävalenz von Suchterkrankungen in der Bevölkerung massive Überrepräsentation suchtkranker Eltern bei Gefährdungsmeldungen, Fremdunterbringungen und Sorgerechtsentzügen (z.B. Murphy et al. 1991, Famularo et al. 1992, Besinger et al. 1999, Forrester 2000).
17 Für Forschungsübersichten s. Velleman / Oford 1993, Hampton et al. 1998, Tunnard 2002 b, Fals-Stewart et al. 2003.
18 Beispielsweise ist aus Adoptionsstudien bekannt, dass genetisch vermittelte Vulnerabilitäten vor allem unter belastenden Umweltbedingungen einflussreich werden (z.B. Newlin et al. 2000). Gleiches gilt teilweise für pränatale Schädigungen (z.B. Hans 2002). Nach dem Stress-Akkumulationsmodell potenzieren sich auch Belastungsfaktoren aus der Eltern-Kind-Beziehung und der Familie gegenseitig (z.B. Conners et al. 2003), wobei familiäre Belastung teilweise durch ihren Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung Wirkung entfaltet.
19 Z.B. Hans et al 1999, Luthar et al. 2003.
20 Z.B. Nair et al. 1997, Hans et al. 1999, Klein 2001c.
21 Z.B. Schuler 2002, Catalano et al. 2002.
22 Z.B. Terling 1999.
23 Für Forschungsübersichten s. Dawe et al. 2000, Killeen / Brady 2000, Barnard / McKeganey 2004.
http://213.133.108.158/asd/28.htm
|
|
| nach oben |
|
 |
|
powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos
Design © trevorj
|
